
Sibylle Grimbert, Der Letzte seiner Art, Eisele, 2023
1835: Der junge Zoologe Gus wird vom Naturhistorischen Museum in Lille nach Island geschickt, um die Fauna des Nordatlantiks zu studieren. Dort wird er Zeuge eines Massakers an einer Kolonie von Riesenalken, einer pinguinähnlichen Vogelart. Gus kann einen der Vögel retten, ohne zu ahnen, dass er gerade das letzte Exemplar seiner Art geborgen hat. Er nennt ihn Prosp – und zwischen dem neugierigen Forscher und dem anfänglich misstrauischen Tier entsteht eine tiefe Freundschaft. Gus wird nach und nach klar, dass er womöglich etwas Einzigartiges und Unvorstellbares miterlebt: Das Aussterben einer Spezies. Was bedeutet es, ein Tier zu lieben, das es nie wieder geben wird? Gus entwickelt eine Obsession mit dem Schicksal seines gefiederten Freundes – eine Obsession, bei der alles andere auf der Strecke bleibt ...
Leseprobe / Seite 47-52
[…] Das Meer war leicht bewegt, aber nicht stürmisch, was sich gut traf, denn nachts war die Gischt das, was noch am besten zu erkennen war. Beim Verlassen des Hauses hatte Gus noch daran gedacht, die Leine mitzunehmen, die zufällig am Kleiderständer neben der Eingangstür hing. Auf den fünfzig Metern, die ihn vom Meeresufer trennten, hatte der in seinen Armen eingeklemmte Riesenalk zunächst gezappelt, irgendwann aber damit aufgehört, als hätte ihn die ganze Aufregung zu sehr erschöpft. Seine Füße waren an Gus’ Bauch hin und her gerutscht, und manchmal hatten die Krallen – ob vor Erstaunen oder vor Begeisterung – die Strickjacke und sogar das Hemd durchdrungen und Gus die Haut zerkratzt. Gus ging festen Schrittes, doch er merkte, dass er wie ein Automat funktionierte, denn in seinem umnebelten Kopf war alles auf ein einziges Ziel gerichtet, dessen Plausibilität nicht einmal gesichert schien.
Dabei war es ganz einfach, ein Gedanke hatte sich ihm aufgedrängt: Er würde den Riesenalk ins Meer lassen. Die Leine musste ihm um den Fuß gebunden werden, wie man es auch auf den Booten praktizierte. Er hoffte dabei auf eine gewisse Benommenheit des Vogels. Wer wie ein Automat funktioniert, hat den unschätzbaren Vorteil, dass er sehr präzise agiert und gegebenenfalls keine Bedenken hat, einen Vogelfuß zu packen, den sich instinktiv wehrenden Körper des Tiers mit einem Knie niederzudrücken und ihm ein Seil stramm ums Bein zu binden. Und das tat Gus mit klarem Erfolg. Als er fertig war, hätte er nicht einmal sagen können, ob der Vogel währenddessen geschrien hatte. Durch den Wind und die Wellen wirkte das Tier jedenfalls wie betäubt.
Er setzte den Riesenalk auf den steinigen Strand. Er erinnerte sich an Strände im Norden Frankreichs, wo er über Sand gelaufen war, und hatte das Gefühl, dass es dort einfacher war, sich zu bewegen als hier, aber der Riesenalk war schließlich daran gewöhnt. Tatsächlich watschelte er langsam voran, und als er im zentimetertiefen Wasser angelangt war, legte er sich sofort flach hinein. Plötzlich ging eine Veränderung in ihm vor, die vielleicht mit dem Aufgehen eines Brotteigs vergleichbar war. Nicht dass er wirklich dicker oder größer wurde, aber er schien aufzublühen, sich zu entfalten, seine eigentliche Gestalt wiederzugewinnen, so wie ein schlaffer Handschuh wieder in Amt und Würden tritt, wenn man ihn anzieht. Vielleicht wollte er sich, als er den Kopf ins flache Wasser tauchte und seinen Körper erst in die eine und dann die andere Richtung drehte, vom Schmutz des Festlands befreien. Gus sah nur den weißen Bauch, der auftauchte und gleich wieder versank. Und plötzlich war er ganz verschwunden.
Es dauerte nur wenige Sekunden, Gus hatte noch keine Zeit gehabt, sich Sorgen zu machen, da spürte er, wie sich die Leine spannte. Der Riesenalk zog so kräftig daran, dass Gus sie sich mehrmals ums Handgelenk wickelte. Mit dieser Kraft hatte er nicht gerechnet. Er stand am Meeresufer, und die Leine grub sich in seine rechte Hand, scheuerte sogar schon an der linken, die er zur Unterstützung dazu genommen hatte. Er lehnte sich mit dem ganzen Körper zurück, was ihn wegen der Steine unter seinen Füßen etwas aus dem Gleichgewicht brachte. Der Riesenalk tauchte immer noch nicht auf, aber Gus war sich nicht sicher, ob er ihn in der Dunkelheit überhaupt gesehen hätte. Ein Kampf hatte begonnen, und er wusste, dass er ihn zumindest in Sachen Ausdauer verlieren würde. Er musste also ziehen, und zwar mit aller Kraft, und den Vogel schnell an den Strand zurückholen. Doch der schien unter Wasser kunstvolle Haken und Saltos zu schlagen. Gus spürte, dass weniger die Kraft des Tiers als seine Beweglichkeit ihn am Ende ermüden würde, zu unbeholfen stand er auf den unebenen, spitzen Steinen, die ihm zudem keine Sitzfläche boten, von wo aus er besser und bequemer sein ganzes Gewicht hätte einbringen können.
Er ging ins Meer, watete bis ins knietiefe Wasser. Es war eiskalt, aber die Anspannung betäubte längst seine Sinne. Er hockte sich nieder, nein, setzte sich, das Wasser reichte ihm nun bis zur Brust. Die Steine störten jetzt weniger. Hin und wieder brach sich eine Welle in Schulterhöhe. Dass die Dünung ihn in die gewünschte Richtung, nämlich zum Strand hin trieb, gab seiner Gegenwehr zusätzlichen Elan, und er merkte, dass der Riesenalk am anderen Ende der Leine allmählich näherkam. Er spürte die Kälte nicht mehr, spürte die Schmerzen nicht mehr und hätte nicht sagen können, wie lange dieser Kampf schon dauerte. Als er später darüber nachdachte, kam er zu dem Schluss, dass es insgesamt nicht länger als zehn Minuten hatten sein können.
Er hatte gefürchtet, den Riesenalk zu verlieren. Anfangs hatte er ihn als einen Feind wahrgenommen, dem er kaum mehr Sympathie entgegenbrachte als einem Strafgefangenen auf der Flucht, dann als ein Lebewesen, das nicht merkte, welchen Risiken es sich aussetzte, und deshalb seinen Schutz brauchte. Doch als der Kampf zu Ende ging und der Vogel direkt vor Gus, der noch in der flachen Brandung saß, wieder auftauchte, sah er vor allem ein Tier. Ein Tier, das allein war. Genauso allein wie er selbst, verloren in diesem Element, das nicht sein Element war, durchgefroren und nass, mit am Körper klebenden vollgesogenen Kleidern. Der Vogel entfernte sich nicht mehr, sondern ließ sich wie eine Ente auf dem Wasser treiben. Es war unglaublich: Der Riesenalk schien glücklich zu sein.
Gus holte tief Luft. In der Dunkelheit konnte er den Vogel kaum ausmachen, aber das war nicht wichtig, er spürte seine Gegenwart und glaubte, dass der andere auch seine spürte. Die Situation hatte sich gedreht, nun war Gus derjenige, der in der Welt des anderen und somit am falschen Ort war. Also betrachtete er sie, diese dunkle, unheimliche, brutale Welt, horchte auf ihre Geräusche, den Wind, die Wellen, die Dünung. Diesmal bewunderte er den Riesenalk, und weil er ihn bewunderte, dachte er darüber nach, dass das Aussterben dieses Tiers, sollte es eines Tages dazu kommen, ein trauriges Ereignis wäre, ein Wissensverlust, weil mit diesem Tier eine Form des sich Bewegens im feindlichen Element verschwinden würde, und noch dazu eine Form des sich Bewegens, die ganz anders war als die der Seevögel, die flogen, der Robben, die schwammen, und der Fische, die für Gus im Wasser unsichtbar waren.
Endlich stand Gus auf. Der Wind schien ihm bis ins Knochenmark zu dringen; er war völlig durchgefroren, und bestimmt waren seine Lippen aufgesprungen. Nochmals packte er den Vogel, der sich wehrte, aber nur ein bisschen, ohne zu beißen, wie ein Haustier. Wie eine Katze, die ihre Krallen in den Teppich bohrt und es sich trotzdem gefallen lässt, dass man sie hochnimmt. Sie gingen nach Hause, der Riesenalk wahrscheinlich zufrieden draußen in der Nacht, Gus starr vor Kälte in seinen nassen Kleidern und erschöpft, als er endlich die Tür öffnete. Bevor er sich abtrocknete, brachte er das Tier noch ins Arbeitszimmer – aber nicht in den Käfig. Als er das Zimmer wieder verließ, sah er den sonst so unbeholfenen Vogel gerade noch wie eine schlanke, spiegelglatte Rakete davonschießen, bis er flach unter der Kommode lag. Gus zog sich vor dem Kamin endlich aus und schlief ein, im Sessel, unter einer Decke, so nah wie möglich ans Feuer gerückt. […]

Laura van den Berg, Das dritte Hotel, Penguin, 2020
Mit einem Flug ins sommerliche Kuba beginnt für Clare eine Reise in die Vergangenheit. Erst wenige Wochen zuvor hat sie ihren Mann Richard bei einem Unfall verloren. Nun besucht sie, die Vertreterin für Aufzugsanlagen, auf seinen Spuren ein Filmfestival in Havanna, wo Richard plötzlich überraschend vor ihr steht. Kann sie ihren Sinnen trauen oder will jemand sie täuschen? Clare folgt der geheimnisvollen Gestalt durch die Gassen der Stadt und gedanklich bis in die Grauzonen ihrer Ehe und Kindheit. Van den Bergs traumwandlerischer Roman spielt mit den Grenzen unserer Wahrnehmung, lässt Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen. Eine poetische Geschichte über das Reisen und das Trauern.
Leseprobe / Seite 97-98
[…] Clare war in ihrem Leben ein einziges Mal in einem Aufzug stecken geblieben, in einer Puppenfabrik in Heltonville, Indiana. Eine Funktionsstörung der Seile brachte die Kabine zwischen zwei Stockwerken zum Stillstand. Sie war mit dem Meister unterwegs, der ihr, als es passierte, gerade die Abläufe bei der Herstellung von Puppenköpfen erklärte. Abgesehen von seiner Faszination für Puppenköpfe hatte der Mann bis dahin völlig normal gewirkt.
Über den Alarmknopf erreichten sie den Notdienst, danach hieß es warten. In einem Bordmagazin hatte sie einmal gelesen, der stillste Ort der Welt sei ein schalltoter Raum in Minnesota. Länger als fünfundvierzig Minuten habe es darin noch niemand ausgehalten. Sie war sich sicher, dass sie nicht besser abschneiden würde.
In der Stille des Aufzugs begannen ihre Arme zu jucken, und sie war erleichtert, als der Meister das Schweigen brach – bis er ihr eröffnete, er habe gerade gesehen, wie ihre Seele den Körper verließ. Anscheinend passierte es dauernd, dass Seelen Körper verließen. Brauchte nicht jedes Wesen hin und wieder eine Auszeit? Seiner Meinung nach wurde es nur dann zum Problem, wenn die Seele keinen Grund sah zurückzukommen. Ihre Seele habe er zunächst aus der Brust aufsteigen sehen, be-richtete er, trat einen Schritt auf sie zu und legte seine sommersprossige Hand fest auf ihr Schlüsselbein, dann habe sie wie ein geflügeltes Fabelwesen eine Weile auf ihrer Schulter gesessen, und als klar wurde, dass Clare in keinster Weise merkte, was los war, nun ja …
Der Meister zuckte mit den Schultern und seufzte, als wäre der Abgang einer Seele furchtbar schade, aber eben eine Sache, auf die man wenig Zugriff hatte. Clare erwiderte, sie gehe davon aus, dass eine Seele einen Körper nur dann verließ, wenn jemand starb, und da begann der Mann in einer Weise zu lachen, die zu erkennen gab, dass er nur selten in seinem Leben etwas Blödsinnigeres gehört hatte. Und Sie glauben, dass das passiert, wenn Menschen sterben?, sagte er und blickte kopfschüttelnd hinauf zur Klappe in der Kabinendecke, aus der sich ihnen kurz darauf die Hände ihrer Retter entgegenstreckten.
An jenem Abend in Heltonville stellte sie sich im Fitnessstudio des Hotels aus einer plötzlichen Regung heraus auf die Waage: Über Nacht hatte sie anderthalb Kilo abgenommen. Sie war sich ziemlich sicher, dass eine Seele weniger als anderthalb Kilo wog, vielleicht gar keine physikalische Masse hatte, aber trotzdem war es ein gruseliges Gefühl. Am nächsten Tag hätte sie eigentlich noch einmal in die Fabrik gehen sollen, stattdessen fuhr sie pflichtvergessen mit dem Auto durch die Gegend, und die Fülle der Landschaft gab ihr Trost.
Dieser Meister war, was die Vorgänge im Reich des Spirituellen betraf, von einer vollkommen anderen Idee besessen, und er hatte mit einer Überzeugung gesprochen, die in dieser Situation lächerlich gewirkt hatte. Doch wer konnte schon mit Sicherheit sagen, dass der Mann sich täuschte, dass die Leere, die manche Menschen in bestimmten Momenten ihres Lebens erfasste, nicht doch damit zu tun hatte, dass ihre Seele – vielleicht vorübergehend, vielleicht für immer – den Körper verließ.
Niemand konnte das. […]

Joe Baker, Ein Ire in Paris, Knaus, 2018
Samuel Beckett, der Nobelpreisträger, galt lange als eigenbrötlerischer, unpolitischer Autor. Dass er in den 30er Jahren durch Nazideutschland reiste und im Zweiten Weltkrieg in der Résistance aktiv war, hat er lange verschwiegen. Erst in jüngster Zeit wurde mit der Veröffentlichung einiger Briefe und Tagebücher dieser Abschnitt in Becketts Leben ausgeleuchtet. In ihrem biografischen Roman über Becketts Pariser Zeit nähert sich Jo Baker dem rätselhaften Autor über die dunklen Jahre seiner künstlerischen Anfänge und führt uns erzählerisch beeindruckend vor Augen, wie die entbehrungsreichen Kriegsjahre und das endlose Warten auf ein Ende Becketts Werk geprägt haben, das Jahrzehnte später weltbekannt wurde.
Leseprobe / Seite 149-151
[…] Kapitel 10
Paris, August 1942
Die Standuhr tickt. Ruckelnd senkt sich eins der Gewichte an seiner Kette. Irgendwo im Inneren der Uhr klappert und verschiebt sich etwas, und sie beginnt die Viertelstunde zu schlagen.
Viertel nach drei also.Er spreizt die Zehen, lässt seine Knöchel kreisen.
Viertel nach drei am Freitag, dem einundzwanzigsten August neunzehnhundertzweiundvierzig.Wenn die Uhr richtig geht.
Vorsichtig dreht er den Kopf hin und her. Solche kleinen Bewegungen kann er noch ausführen. Und weil er es kann, scheint es wichtig, es auch zu tun. Licht strömt durch ein Astloch, wenn er den Kopf nach links dreht, und sickert durch die Dielenritzen, von denen manchmal feine Staubwölkchen herabsinken. Wenn er ihn nach rechts dreht, sieht er den schwarzen, rechteckigen Fleck auf den Holzdielen, das ist der Teppich, der die losen Planken verdeckt, durch die sie hinausklettern, wenn sie raus dürfen. Und dann ist da noch der alte Mann, der neben ihm liegt.
Inzwischen hat er sich an die vielen Gerüche gewöhnt. Die des alten Mannes und seine eigenen. Den Körpergeruch und den schlechten Atem nimmt er kaum noch wahr; nur wenn einer von ihnen einen besonders widerwärtigen Furz lässt – bedingt durch die schlechte Nahrung und die durch den Mangel an Nahrung entstehende Säure, die den Magen verätzt und die Gedärme in Melasse verwandelt –, fällt ein übler Geruch eigentlich noch auf. Interessant, an was man sich alles gewöhnen kann.
Der alte Mann hat eine beneidenswerte Gabe zu schlafen. Unter seinem weißen Bart hebt und senkt sich leise die Brust. Sein Gesicht ist faszinierend: die Haut rutscht ihm von der Stirn über die Wangenknochen bis zu den Ohren, wo sie sich sammelt wie die Falten einer Ziehharmonika, während Nasenrücken und Augenhöhlen umso deutlicher hervortreten. Wenn er ein bisschen den Kopf hebt, kann er an ihren nebeneinanderliegenden Körpern entlangblicken und die Füße des alten Mannes sehen, wo ein gelber Zeh aus einer grauen Socke ragt.
Manchmal schnarcht der alte Mann. Er lässt ihn schnarchen, stupst ihn nicht an. Auch er kann mit viel Glück manchmal ein bisschen wegdämmern, ein jäher Sturz in eine Kaskade von Bildern, die in so rasanter Folge vorbeirasen, dass sie nicht zu verstehen sind. Dann reißen sie plötzlich ab, und er blickt wieder auf die Holzdielen über seinem Kopf.
Wenn er die Schultern bis zu den Ohren hochzieht, rutschen die Schulterblätter wie gestutzte Flügel über die Planken unter ihm.
So schlimm ist es nicht, eigentlich nicht. Es ist nicht so schlimm.
Wenn der alte Mann wach ist, kämmt er sich manchmal mit den Fingern den Bart und brummt dabei vor sich hin. Er ist Russe. Was er sagt, könnten Gebete sein, es könnte aber auch sein, dass er Geschichten erzählt oder sich einfach nur bessere Zeiten in Erinnerung ruft. Allerdings hat der alte Mann einen wachen Zuhörer, der vertraute Klänge, Namen und Wiederholungen heraushört und versucht, ihnen einen Sinn zu entlocken.
In dem Spalt zwischen Decke und Boden lernt er Russisch.Schnell geht es nicht.Aber es hat ja auch keine Eile.
Es beruhigt ihn, wenn der alte Mann zu brummen beginnt. Es hilft ihm, die Zeit herumzubringen.
Wobei es hier unten zwischen Boden und Decke schon auch Dinge gibt, die erledigt werden müssen. Dafür steht eine Flasche zwischen ihnen. Leer wird sie von der Frau gebracht und, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat, wieder mitgenommen. Man knöpft den Hosenschlitz auf, windet sich, stützt sich, so gut es geht, auf die Ellbogen und dann wird unter großen Schwierigkeiten gepisst, während der andere den Kopf wegdreht oder oft genug bereits schläft. Alles in allem stellt er fest, dass er dem alten Mann freundliche Gefühle entgegenbringt. Er ist ein eleganter Pisser und ein zuvorkommender Schläfer; er furzt nicht so oft, wie man vermuten könnte. Wenn man schon Gesellschaft haben muss, ist dies keine schlechte Gesellschaft.
Es gibt auch Stunden, die in der Wohnung verbracht werden, bei laufendem Radio, wenn die Eheleute daheim sind und niemanden erwarten. Dann sitzt der alte Mann in der Ecke neben der Standuhr, während er selbst wie das fünfte Rad am Wagen versucht, nicht im Weg zu sein und sich von den Fenstern fernzuhalten. Das geht nur dann, wenn der Tag vorbei ist, die Geschäfte im Erdgeschoss leer und es normal scheint, dass jemand zu Hause ist. Denn jedes noch so kleine Vorkommnis, das irgendwie aus dem Rahmen fällt, wird jetzt hinterfragt. Ein Wort von einem besorgten Bürger über Fremde im Haus, über Gestalten in einer vermeintlich leeren Wohnung, und sie wären geliefert.

Elizabeth Gilbert, Das Wesen der Dinge und der Liebe, Bloomsbury Berlin, 2013
Alma Whittaker wird an einem perfekten Wintertag des Jahres 1800 in Philadelphia geboren. Dem jungen unabhängigen Mädchen fehlt es an nichts, auch nicht an Bildung. Der Aufbruch der Wissenschaft wird auch ihr Aufbruch in eine eigene Welt: die der Pflanzen und Natur. Während ihr klarer Verstand sie zu einer brillanten Wissenschaftlerin macht, zeigt ihr die Liebe zu einem Mann, dass nicht alle Geheimnisse zu ergründen sind. "Das Wesen der Dinge und der Liebe" umkreist die Erde, von London nach Peru, nach Philadelphia, nach Tahiti und Amsterdam. Die Entdeckungsreise einer ganz und gar ungewöhnlichen Frau – und eine große Liebesgeschichte.
Leseprobe / Seite 79-82
[…] Almas Vater mochte weder die Kirche noch die Religion, er nahm Gott allerdings gern in Anspruch, wenn es darum ging, seine Feinde zu verfluchen. Die Liste der Dinge, die Henry nicht mochte, war lang, und Alma kannte sie gut. Sie wusste, dass ihr Vater große, korpulente Männer hasste, die kleine Hunde hielten. Er hasste auch Menschen, die schnelle Pferde kauften, obwohl sie nicht reiten konnten. Ferner hasste er: Vergnügungssegelschiffe, Landvermesser, billige Schuhe, Frankreich (die Sprache, das Essen, die Menschen), reizbare Büroangestellte, kleine Porzellantellerchen, die in Männerhänden sowieso nur zerbrachen, Gedichte (außer Lieder!), rückgratlose Feiglinge, stehlende Hurensöhne, verlogene Zungen, den Klang von Geigen, die Armee (jede Armee), Tulpen ("Zwiebeln, die sich wichtig machen!"), Blauhäher, Kaffeetrinken ("eine elende Angewohnheit der Holländer!") und schließlich – wobei Alma noch nicht ganz verstand, was die beiden Begriffe eigentlich bedeuteten – sowohl die Sklaverei als auch die Abolitionisten.
Henry konnte ein gehöriger Unruhestifter sein. So rasch wie andere ihre Weste aufknöpften, war er imstande, Alma zu kränken und zu verunglimpfen ("Niemand kann ein dummes, eigennütziges kleines Ferkel leiden!"), doch es gab auch Momente, in denen er sie nachweislich gern hatte, ja sogar stolz auf sie war. Einmal kam ein Fremder nach White Acre, um Henry ein Pony zu verkaufen, auf dem Alma das Reiten erlernen sollte. Das Pony hieß Soames, es war weiß wie Puderzucker, und Alma liebte es auf den ersten Blick. Man verhandelte über den Preis. Die beiden Männer einigten sich auf drei Dollar. Alma, gerade erst sechs Jahre alt, fragte: "Entschuldigen Sie, Sir, aber sind Sattel und Zaumzeug, die das Pony gerade trägt, auch im Preis enthalten?"
Der Fremde reagierte unwirsch auf ihre Frage, während Henry vor Lachen brüllte. "Da hat die Kleine Sie aber drangekriegt, Mann!", grölte er, und jedes Mal, wenn Alma an diesem Tag in seine Nähe kam, zauste er ihr das Haar und sagte: "Was habe ich doch für eine gute Geschäftsfrau als Tochter!"
Alma lernte, dass ihr Vater abends aus Flaschen trank, die mitunter Gefahren bargen (Geschrei, Vertreibung), hingegen auch Wunder bewirken konnten – etwa die Erlaubnis, auf ihres Vaters Schoß zu sitzen, wo sie möglicherweise phantastische Geschichten und vielleicht sogar ihren kostbaren Kosenamen zu hören bekam: Plum, Pflaume. An solchen Abenden erklärte ihr Henry Dinge wie: "Du solltest immer genug Gold dabeihaben, Plum, damit du, falls du entführt wirst, dein Leben zurückkaufen kannst. Wenn es nicht anders geht, näh es dir in den Rocksaum, aber hab immer Geld dabei!" Henry erzählte ihr, dass sich Beduinen in der Wüste Edelsteine unter die Haut nähten, für Notfälle. Er erzählte ihr, dass auch er sich am Bauch einen südamerikanischen Smaragd unter die lose Haut genäht habe, und wer nichts davon wisse, würde denken, es sei die Narbe einer Schussverletzung – nie im Leben würde er sie ihr zeigen, doch der Smaragd sei wirklich da. "So ein letztes Bestechungsgeld braucht man, Plum", sagte er.
Auf dem Schoß ihres Vaters erfuhr Alma, dass Henry mit einem bedeutenden Mann namens Kapitän Cook um die Welt gereist war. Das waren die allerbesten Geschichten. Einmal war ein riesiger Wal mit aufgerissenem Maul aus dem Ozean aufgetaucht, und Kapitän Cook hatte das Schiff direkt in den Wal hineingesteuert, hatte sich einmal in seinem Bauch umgeschaut und war wieder hinausgesegelt – rückwärts! Ein anderes Mal hatte Henry auf dem Meer ein Weinen gehört und eine Seejungfrau erblickt, die auf dem Wasser trieb. Ein Hai hatte die Seejungfrau verletzt. Henry zog sie mit einem Seil an Bord, und sie starb in seinen Armen. Doch vorher, bei Gott, vorher hatte sie Henry Whittaker noch gesegnet und ihm gesagt, dass er eines Tages ein reicher Mann werden würde. Und so war er an dieses große Haus gekommen – weil ihm die Seejungfrau ihren Segen erteilt hatte!
"Welche Sprache hat die Seejungfrau gesprochen?", wollte Alma wissen. Ihrer Vorstellung nach musste es so etwas wie Griechisch gewesen sein. "Englisch!", antwortete Henry. "Mein Gott, Plum, warum zum Teufel sollte ich eine ausländische Seejungfrau retten!"
Alma empfand eine fast ehrfürchtige Bewunderung für ihre Mutter, doch ihren Vater betete sie an. Sie liebte ihn mehr als alles auf der Welt. Sie liebte ihn mehr als Soames, das Pony. Ihr Vater war ein Koloss, zwischen dessen riesigen Beinen sie hervorlugte und sich die Welt ansah. Im Vergleich zu Henry war der himmlische Vater langweilig und sehr weit weg. Doch wie Gottvater aus der Bibel stellte auch Henry Almas Liebe hin und wieder auf die Probe, vor allem dann, wenn die Flaschen geöffnet waren. "Plum", sagte er beispielsweise. "Warum läufst du nicht, so schnell dich deine spindeldürren Beine tragen, runter zum Anleger und schaust mal nach, ob für deinen Papa Schiffe aus China gekommen sind?"
Bis zum Anleger waren es sieben Meilen, und der Weg führte über einen Fluss. Es konnte neun Uhr abends sein, Sonntag, und draußen ein bitterkalter Märzsturm wüten – Alma sprang trotzdem vom Schoß ihres Vaters und rannte los. Ein Diener musste sie an der Tür abfangen und in den Salon zurücktragen, sonst hätte sie es wahrhaftig getan, mit ihren sechs Jahren, ohne Mantel und Mütze, ohne einen Penny in der Tasche oder auch nur das kleinste bisschen Gold im Rocksaum. […]

Harriet Walker, Less is more. Minimalismus in der Mode, Collection Rolf Heyne, 2012
Weniger ist mehr! Was Mode betrifft, so ist weniger in der Tat meist mehr. In Less is More ergründet die Modejournalistin Harriet Walker diese These und damit eines der wichtigsten Stilmittel der Mode. Der Minimalismus entstand im frühen 20. Jahrhundert, als Frauenkleidung nach einem Jahrhundert komplexer Schnitte plötzlich »praktisch« und einfach wurde. Harriet Walker geht auf die Designer und Modeschöpfer ein, deren Kleider die Frau aus den Zwängen des Opulenten befreiten, von Coco Chanel über Pierre Cardin bis hin zu Designs von aktuellen Labels wie COS. Sie zeigt, dass der Minimalismus die Mode so sichtbar und kontinuierlich beeinflusst hat wie kaum ein anderes Konzept.
Leseprobe / Seite 9 und 10
[…] Die Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert ist auch eine Geschichte des Minimalismus. Es gibt kaum einen theoretischen Ansatz, der von so vielen einflussreichen Modedesignern aufgegriffen wurde und in die unterschiedlichsten Bereiche einfloss. Die besten und größten Namen der modernen Modewelt, von Coco Chanel und Cristóbal Balenciaga über Rei Kawakubo und Martin Margiela bis hin zu Hussein Chalayan, haben sich vom Minimalismus inspirieren lassen und seine Prinzipien zur Ausdrucksform erhoben. Man könnte den Minimalismus als eine Art Ausgangspunkt bezeichnen, eine Tabula rasa, auf der Designer in schwierigen Zeiten immer wieder neue Inspiration finden. Genauso wie das Zeichnen eine Grundvoraussetzung für die Malerei ist, formulieren sich im Minimalismus gewissermaßen die Grundbausteine des Modedesigns. Doch obwohl der Minimalismus auf dem Wesentlichen basiert, hat auch er eine Entwicklung durchlaufen, die sich an seinem mal stärkeren, mal schwächeren Einfluss auf die unterschiedlichen soziohistorischen Zusammenhänge festmachen lässt. Diese Geschichte gilt es hier zu erzählen.
Das Konzept des Minimalismus zu umreißen, ist nicht einfach. Einerseits definiert er sich etwas nebulös durch das, was er nicht ist; andererseits lässt er sich als eine strenge, restriktive Ästhetik begreifen, nach der man arbeiten und leben kann. Offiziell entstand der Begriff in den sechziger Jahren, als eine Gruppe von Künstlern in New York gegen die traditionellen Darstellungsweisen der Malerei und Bildhauerei aufbegehrte und beschloss, nach eigenen Ausdrucksformen zu suchen, die möglichst wenig an die physische Existenz gebunden sein sollten. In den sechziger Jahren machte sich der Künstler Donald Judd einen Namen, indem er mit industriellen Materialien abstrakte Werke schuf, die sich jeder unwillkürlichen Kategorisierung entzogen und der Reinheit von Farbe und Form auf den Grund gingen. Seine Skulptur Untitled (folgende Seite) besteht aus einer Reihe von anodisierten Aluminium- und Acrylplatten, die – ohne sich zu berühren – übereinandergestapelt wie Tabletts an einer Wand befestigt sind. Judd beschrieb seine Arbeit als den "einfachen Ausdruck eines komplexen Gedankens", was auch das Konzept einer minimalistischen Modeästhetik recht gut umreißt: von Beginn an ging es darum, pragmatische und funktionelle, aber technisch hochwertige Kleidung für Frauen zu schaffen.
Die Geburtsstunde dieses Gedankens liegt jedoch länger zurück. Genau hier beginnt unser Buch. Die Vereinfachung der Kleidung, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erfolgte, ist zweifellos minimalistisch avant la lettre, aber kann man diesen Begriff – schließlich war die entsprechende "Parole" noch gar nicht ausgegeben – wirklich darauf anwenden? Selbstverständlich kann man. Künstler wie Architekten arbeiteten schon lange vor der minimalistischen Bewegung nach den Prinzipien der Moderne, und die elegante Reduzierung, für die Modeschöpfer wie Coco Chanel eintraten, darf man ebensogut "modernistisch" wie "minimalistisch" nennen. Entscheidend ist, dass ihre Arbeit in erster Linie darauf abzielte, alles Unnötige, die Funktion Beeinträchtigende zu eliminieren. Genauso wie moderne Romanautoren von den rhetorischen Schnörkeln des viktorianischen Zeitalters Abstand nahmen oder die Bauhaus-Bewegung der zwanziger Jahre Praxistauglichkeit und Pragmatismus in den Vordergrund stellte, wollten die frühen Modedesigner die Werte damaliger Damenmode neu definieren. Modernität war zu diesem Zeitpunkt Vereinfachung im Sinne einer Klärung der Linie.
Definitionen des Begriffs Minimalismus bleiben häufig abstrakt, weshalb sich der vorliegende Text bemüht, für jeden thematisierten Modedesigner an konkreten Beispielen zu verdeutlichen, warum seine Kleider als minimalistisch eingestuft werden dürfen. Generell kann man sagen, dass ein entscheidender Punkt der Verzicht auf jegliche Formen von Verzierung ist. Ein mit Blumenapplikationen bedecktes Kleid von Balenciaga ist nicht unbedingt minimalistisch, doch die Kleider der Amphora-Linie desselben Designers mit ihren klaren Formen und schmucklosen Oberflächen sind es sehr wohl. Verzierung und Minimalismus schließen sich zwar nicht gegenseitig aus, aber jede Form von Dekoration muss aus der Struktur eines Kleides hervorgehen. An einem Kleidungsstück sollte es nichts geben, was für die Gesamtstruktur irrelevant ist, jedes Element sollte ein wesentlicher Teil des Ganzen sein. Der Minimalismus meidet das Überflüssige und Oberflächliche. […]

Charles Dantzig, Wozu lesen?, Steidl (L.S.D.), 2011
Wozu lesen? ist das leidenschaftliche Plädoyer eines Granden der französischen Kulturszene für die Lektüre in einer von Bildern dominierten Welt. Elegant und charmant wirbt er für die Literatur als Stimulanz unserer Intelligenz und als Schlüssel zur Welt.
Leseprobe / Seiten 32 und 98-102
Seite 32Lesen belebt neu Wir lesen aus purem Egoismus, bewirken damit jedoch ungewollt etwas Altruistisches. Denn durch unsere Lektüre hauchen wir einem schlafenden Gedanken neues Leben ein. Was ist ein Buch, wenn nicht Dornröschen, was ist ein Leser, wenn nicht ihr Märchenprinz, selbst wenn er eine Brille trägt, kaum noch Haare auf dem Kopf hat und achtundneunzig Jahre auf dem Buckel? Ein geschlossenes Buch existiert, aber es lebt nicht. Es ist ein Quader, wahrscheinlich mit einer feinen Staubschicht bedeckt und nichts als eine leere Schachtel. Man könnte sagen, jede Lektüre ist eine Wiedererweckung. Mallarmé hat übertrieben, als er behauptete, der Leser sei der Schöpfer eines Gedichts. "Wiederbeleber" hätte genügt. Wir sind erwachsen genug, um den Leser, so wichtig er auch sein mag, nicht mit dem Schöpfer eines Werkes zu verwechseln.
Seiten 98-102Lesen heißt, sich tätowieren lassen Wenn es dem Leser gelänge, sich von allen Sätzen, die ein Schriftsteller geschrieben hat, einen, nur einen einzigen zu merken, der in die Erinnerung eingebrannt alle anderen in sich trüge, so wäre dieser Schriftsteller gerettet. Denn eine solche Erinnerung hält das Interesse des Lesers wach, seine Zuneigung, und macht die nochmalige Lektüre möglich.
"Ist das Werk einmal dem Urteil der Menschen entzogen, geht es unter entsetzlichen Qualen zugrunde."Samuel Bekett, Die Welt und die Hose
Wir Franzosen haben eine große Schwäche für die Verfasser von Maximen. Sie tätowieren uns für immer den Geist. Ihre Bücher sind wie Buden, deren Wände nicht mit Drachen, Delfinen, Totenköpfen oder Tribal-Motiven, sondern mit Aphorismen gespickt sind. Begeistert blöken wir ihre Sätze nach wie eine Heerschar intellektueller Schafe, die ein Polemiker einmal als die "Internationale der Zitationisten", getauft hat (allerdings hat er da selbst wohl ein bisschen zitiert).
"Mein Geist entgleitet mir. Ich muss ihn hinterrücks wieder einfangen, indem ich spreche."Susan Sontag, Wiedergeboren
[…] Maxime kommen dem Schriftsteller so nah wie es die Schrift vermag. Sie sind beinahe unmittelbare Äußerung seines Denkens und Fühlens. Sie sind kein Extrakt, sondern Essenz. Vollendet, ausgefeilt, perfekt. Ein Geschoss, das der Autor auf die von ihm selbst benannte Spezies "Mensch" abfeuert. Der Verfasser von Maximen ist häufig ein Misanthrop. Im Allgemeinen ist sein Leben alles andere als eine Erfolgsgeschichte. La Rochefoucauld misslingt seine militärische Karriere, Vauvenargues scheitert mit der Fronde, und Chamfort ist gewissermaßen ein geborener Versager, weil er in einem aristokratischen Jahrhundert als Bürgerlicher das Licht der Welt erblickt. Deshalb klingen in Maximen häufig Illusionslosigkeit, Verachtung und Überdruss an. Maximen sind Pillen für die Verbitterung. Und der Leser ist entzückt darüber. Im Gegensatz zu Romanen, in denen er sich mit den Figuren identifizieren will, kann er den Protagonisten der Maximen, "den Menschen", nach Lust und Laune verachten. "Der Mensch" – so lautet der feinsinnige Name, den ein Verfasser von Maximen seinen persönlichen Feinden gibt. Der Mensch, das ist der Andere; aber nicht der ferne und somit liebenswerte Andere, sondern der nahe, greifbare Andere, dieser Dreckskerl. Der Mensch, das ist der Nachbar. Eigentlich wäre es nur ein kleiner Schritt – den der Leser freilich selten tut -, um zu dem Schluss zu gelangen, dass man selbst irgendwie auch dieser Mensch ist. "Die Dankbarkeit der meisten Menschen ist nur der geheime Wunsch, noch mehr zu bekommen." (François de La Rochefoucauld) Ah, der Mensch, dieses Schwein! Ah, dieses Schwein, das ich nicht bin! Maximen entlarven die Fehler eines Unbekannten, der idealerweise ein Bösewicht ist. Auch Christen mögen manchmal unter den Angeklagten sein (weil sie sich zu ihren Fehlern bekennen), aber niemals die Verfasser von Maximen und nur selten ihre Leser.[…]
"Der russische Mensch besitzt in höchstem Grade die Fähigkeit, erhaben zu denken, aber sagen Sie mir, warum bringt er es im Leben zu überhaupt nichts Höherem?" Veršinin in: Drei Schwestern, Anton Čechov
Solche Autoren nennt man Moralisten. Logischerweise gibt es sie nur in Frankreich, wo die Sitten zu Gericht sitzen und – was noch schlimmer ist – ihre Schlüsse ziehen. Ein Franzose ist ein Mensch, der wissen will, wer mit wem schläft, um daraus Ursachen abzuleiten. Ein Ding der Unmöglichkeit in England, wo man schüchtern ist und sehr viel häufiger auf dem Land lebt (was dasselbe ist). Meistens bedienen sich Maximen eines Gedankenspiels von These und Antithese, zwischen denen der Mensch zermalmt wird wie von einem Nussknacker. Ist dies vielleicht der Grund warum die Maxime nur unter sehr harten Menschen ihr kleines aber treues Publikum findet, unter der gnadenlosen Jugend und dem gefühlskalten Alter?
"Denn Jugend –"Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein
Maxime taugen zur Tätowierung. Sogar Menschen, die solche Lebensregeln normalerweise nicht gerade verschlingen, lassen sie sich ins Fleisch schreiben, wenn sie zufälligerweise auf eine stoßen, die sie bewegt. Und das ist wörtlich gemeint. Der englische Sänger Robbie Williams hat sich folgende Devise auf den Oberkörper tätowieren lassen: "Chacun à son goût."
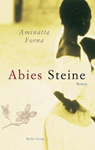
Aminatta Forna, Abies Steine, Berlin Verlag, 2007, LiBeraturpreis 2008
In ihrem Romandebüt zeichnet Aminatta Forna die Porträts von vier sehr unter-schiedlichen afrikanischen Frauen, in deren Lebenswegen sich der Wandel einer ganzen Gesellschaft spiegelt.
Leseprobe / Seite 17-19
[…] Es begann mit einem Brief, wie das bei Geschichten manchmal so ist. Einem Brief, der an einem Wintertag vor drei Jahren hier eintraf, einem Brief, auf dem eine Marke mit einem schwarzweißen Eisvogel klebte, die feuchte Kälte der frischen Luft und der Poststempel eines Ortes, aus dem seit mindestens einem Jahrzehnt kein Brief mehr gekommen war. Aus einem Land, das verschwunden zu sein schien, zurückgekehrt in frühere Zeiten, wie die großen, leeren Flächen auf alten Landkarten, die die Kartenschreiber von einst mit Zeichnungen von mythischen Bestien und unermesslichen Reichtümern füllten. In Wirklichkeit begann diese Geschichte natürlich schon vor Hunderten von Jahren, als Reiter aus einem untergegangenen Königreich namens Futa Djallon in die Ebene kamen – lange bevor sich europäische Kartenschreiber mit der quälenden Frage beschäftigten, wie die leeren Flächen zu füllen seien. Eine Geschichte kommt mir in den Sinn.
Eine Geschichte, die ich wohl schon seit Jahren kenne, obgleich ich mich nicht mehr daran erinnere, wer sie mir erzählt hat.
Vor fünfhundert Jahren segelte eine Karavelle unter der Flagge des Königs von Portugal an der Biegung des Kontinents entlang. Irgendwo auf der Höhe der Kapverdischen Inseln geriet man in eine Flaute, die Vorräte an Nahrung und Wasser wurden knapp. Als die Winde schließlich ein Einsehen hatten, bliesen sie die Karavelle in südwestlicher Richtung auf die Küste zu, wo der Kapitän mehrere natürliche Häfen sichtete und vor Anker ging. Krumm vor Hunger, das Haar vom Skorbut gelockt, ruderten die Seeleute an Land und schleppten sich durchs seichte Wasser den Sandstrand hoch in den Schatten der Bäume. Da standen sie nun und schauten sich ungläubig um. Man stelle sich vor! Baumelnd vor ihren Gesichtern: saftige Mangos, Sternfrüchte, Avocados, jede so groß wie ein Männerkopf. Ananasfrüchte nickten ihnen an ihren eleganten Stielen aufmunternd zu, Süßkartoffeln und Yamsknollen lugten aus der Erde hervor, große Bananenhände streckten sich zu ihnen herab. Die Seeleute glaubten, dass sie nichts Geringeres gefunden hatten als den Garten Eden.
Und genau das glaubten die Europäer, glaubten es lange Zeit: dass Afrika das Paradies sei.
Eine Woche, nachdem jener Brief kam, habe ich das letzte Mal über diese Geschichte nachgedacht. Da hatte ich London – der Stadt, die ich jetzt mein Zuhause nenne – den Rücken gekehrt, um den Weg des Briefes zurückzuverfolgen und dorthin zu reisen, woher er gekommen war, und sogar noch weiter. Ich stand in einem Wald, der nicht anders war als der, in den die Seemänner gestolpert waren. Und erinnerte mich daran, wie ich frühmorgens meinen Großmüttern, den Frauen meines Großvaters, nachschaute, wenn sie ihre Häuser verließen und den Pfad nahmen, auf dem ich jetzt wieder stand, um zu ihren Gärten zu gehen. Eine Frau nach der anderen trennte sich von der Gruppe und ging zu ihrem Stück Land, dessen Grenze ein verlassener Termitenhügel, ein umgekippter Baum oder ein senkrechter Felsblock markierte. Dort, unter den riesigen Iroko-, Sapelli- und Kapokbäumen des Waldes, hegte und pflegte jede die Guaven, die Papayas und Malabaräpfel, die sie gepflanzt hatte. Zwischen den Yamsknollen und Manioksträuchern zog sie das Unkraut aus der weichen, dunklen Erde und goss die Ananaspflanze, die in der Mitte ihres Terrains stand.
Ich dachte an die Seemannsgeschichte. Lange war ich der Meinung, dass es nur das war. Eine Geschichte. Darüber, wie uns die Europäer entdeckt hatten und wir aufhörten, ein weißer Fleck auf der Landkarte zu sein. Aber Monate später, nachdem ich den Brief bekommen hatte, seiner Flugbahn gefolgt und mit einem weichen, dumpfen Aufprall in einem Zauberwald gelandet war, nachdem ich den vielen Geschichten gelauscht hatte, die in diesem Buch enthalten und für dich niedergeschrieben sind, fiel mir diese eine Geschichte wieder ein. Und mir wurde klar, dass sie in Wahrheit von etwas anderem handelt. Sie handelt von einer anderen Sichtweise. Die Seemänner waren blind für die Zeichen, unfähig, das Muster oder die Logik zu erkennen, nur weil sie sich von ihrer unterschied. Die afrikanische Sichtweise: obskur, unsichtbar und doch sichtbar, offenkundig für jeden, der dazugehört.
Was die Seeleute sahen, hielten sie für die Reichtümer der Natur und stahlen es aus den Gärten der Frauen. Sie glaubten, Eden gefunden zu haben, und das war es vielleicht auch. Aber es war ein Eden, das nicht von Gottes Hand, sondern von Frauenhand erschaffen war. […]

Céline Curiol, Von Liebe sprechen, Piper, 2007
Sie ist die Stimme, die jeder hört und niemand kennt. Sie ist jung, sie lebt in Paris und arbeitet an der Gare du Nord. Als Bahnhofsansagerin kündigt sie die an- und abfahrenden Züge an, begleitet sie Abschiede, Trennungen und Hoffnungen. Allein kehrt sie in ihre Wohnung zurück. Dort hofft sie auf den seltenen Anruf des Mannes, den sie liebt. Sie haben sich geküsst in einer Nacht, doch er lebt mit einer anderen Frau, die schön ist wie ein Engel und ihr gegenüber so viele Vorzüge hat. So flüchtet sie sich in die Straßen der Stadt, in die Cafés und Bars an der Seine und in das trubelige Viertel um Les Halles; sie trifft auf Menschen, die so ungewöhnlich sind wie sie selbst und genauso einsam in ihrer Andersartigkeit. Sie tut scheinbar nichts, um zu verführen, und doch kommt der Punkt, an dem er sich ihr nicht mehr entziehen kann.
Leseprobe / Seite 9-11
[…] Sie kennen sich seit langem. Es ist ihr noch nie gelungen, sich den Moment ihrer ersten Begegnung ins Gedächtnis zu rufen, den Ort, den genauen Tag und ob sie ihm die Hand geschüttelt oder seine Wangen geküßt hat. Sie ist auch noch nie auf den Gedanken gekommen, ihn danach zu fragen. Eine erste Erinnerung gibt es jedoch. Als sie sich im engen Flur einer unaufgeräumten Wohnung den Mantel anzog, hatte sie seinen enttäuschten Gesichtsausdruck bemerkt. Die Frau, mit der er den ganzen Abend geflirtet hatte, wollte nicht mit ihm gehen. Hartnäckig versucht er, sie zu überzeugen, aber seine Worte zerfielen vor ihrer erhabenen Gestalt. Die Vorstellung, plötzlich auf den Gegenstand seiner Zuneigung verzichten zu müssen, war ihm, so dachte sie, in diesem Moment unerträglich. Ihn so zu sehen, so verliebt, hatte sie berührt. Sie war zwischen den beiden durchgegangen und hatte gesagt, ich bin dann weg. Aber er hatte ihr nicht geantwortet. An seine Haare und seine Hände erinnert sie sich, immer. Ihre Beschaffenheit, ihre Farbe, ihre Größe, ihre Form hat sie als klares Bild vor Augen. Vielleicht weil sie das sind, was sie am liebsten und als erstes an ihm berühren würde, so als ob sie darüber Zugang zu seinem innersten Wesen bekäme.
Im Schaufenster ist jede Flasche so plaziert, daß sich ihre Position leicht von der ihrer Nachbarin unterscheidet. Auf den Schildchen steht kein Preis. Sie beschließt hineinzugehen. Der Weinhändler will die Zusammenstellung des Abendessens wissen, um ihr bei der Auswahl behilflich zu sein. Sie wagt es nicht, ihm zu sagen, daß sie nicht essen werden, sie fürchtet, daß er sie dann für eine Alkoholikerin hält. Ich bin eingeladen, man hat mir nichts gesagt, erfindet sie schließlich, um dem Anflug von Vorwurf in den Augen des Händlers entgegenzuwirken. Ich nehme Roten und Weißen, das paßt dann auf jeden Fall, fügt sie ergänzend hinzu. Er wählt drei Flaschen aus, sie ist sofort einverstanden. Er wickelt sie in glänzendes Papier, stellt sie senkrecht in die Tüte. Sie geht, am Arm das verheißungsvolle Klirren.
Sie hat auf der Terrasse eines leeren Cafés Platz genommen. Ein Kellner mit aschfahlem Teint, wie aufgehängt an seiner langen Wirbelsäule, nimmt ihre Bestellung entgegen und vergewissert sich dabei, daß außerhalb seines Bereichs alles so ist wie gehabt. Der Espresso kommt zusammen mit der Rechnung. Er ist kalt und bitter. Trotz ihrer Müdigkeit will sie diesen Abend nicht verpassen: Sie würde sich der Freundschaft, die er ihr entgegenbringt, unwürdig erweisen. Bestimmt wird irgend jemand Kerzen mitbringen. Es wäre schade, wenn er nichts zum Ausblasen hätte, keinen Wunsch aussprechen und keine Sahne von kleinen Plastikhaltern lecken könnte, gerade er, dem es so wichtig ist, seinen Geburtstag zu feiern. Sie selbst war schon immer der Ansicht, daß es keinen Sinn ergibt, ihre Ankunft in dieser Welt feierlich zu begehen, aber in seinem Fall kann sie es verstehen. Was ist ein Geburtstag? Man markiert die Zeit, um sie auf ein menschliches Maß zu reduzieren. Der Kellner hat jetzt Dienstschluss, er will kassieren. Seine Handfläche ist ein Netz verworrener Linien, eingraviert von den im Alltag hundertfach wiederholten Bewegungen. Plötzlich hat sie Lust, etwas anderes daraufzulegen als Metall, vielleicht ihre eigene Hand.
In ihrer Wohnung riecht es nach Räucherstäbchen und Lack. Sie nimmt die Flaschen aus der Tüte, stellt sie nebeneinander auf den Küchentisch. Sie zögert, dann öffnet sie die Weißweinflasche, schenkt sich ein Glas ein und wartet darauf, daß es Zeit wird, zu ihm zu gehen.
Die Leute unterhalten sich, hier um ein Sofa, dort um einen Stuhl gruppiert. Man lacht, frotzelt, plappert und schwärmt ohne allzu große Mühe. Das Summen der Gespräche wandert mit ihr von einem Zimmer ins nächste, die Stimmen wechseln die Tonart, zerplatzen wie große Blasen zu nah an ihrem Ohr. Ihr ist jetzt schon schwindelig. Jemand fragt sie, ob sie den Korkenzieher gesehen hat. Sie zuckt mit den Schultern, ihre Kinnmuskeln sind ein bißchen steif. Man reicht ihr Gläser, man stößt mit ihr an, sie trinkt. Es gibt immer mehr fremde Gesichter, und sie haßt es, den ersten Schritt tun zu müssen. Eine aufgekratzte Frau mit gebleichtem Haar rempelt sie beim Verlassen der Toilette an. Sie sucht Blickkontakt, um der Angreiferin ihr Mißfallen kundzutun, aber die Frau marschiert ins Wohnzimmer, ohne sie zu beachten. Sie verriegelt die Tür, hebt ihren Rock und läßt sich schwerfällig auf dem Sitzbecken nieder. Sie gähnt, ihr Kopf ist anderthalb Tonnen schwer, es ist noch nicht einmal Mitternacht. Als sie ihr Schlupfloch verläßt, steht er im Flur. Gerade ist eine Frau gekommen und hat ihm die Arme um die Taille gelegt. Sie heißt Ange. Engel. Sie ist noch fast so wie in ihrer Erinnerung, vielleicht ein bißchen freundlicher als bei ihrer ersten Begegnung an der Wohnungstür. Sie lächeln sich zu. Ja, denkt sie, die beiden passen ziemlich gut zueinander. Er hat seine Wette also gewonnen: Der rebellische Engel hat sich erobern lassen und nimmt an seinem großen alljährlichen Fest teil. Jetzt erst sieht sie die weißen Flügel auf Anges Rücken. Zwei kleine, harmlose Flügelchen, deren Flaum so seidig ist, daß er die schlimmste Schlaflosigkeit beenden kann. Er hat diese Flügel berührt, und das ist es, was ihm gefallen hat. Wer könnte solchen Engelsflügeln schon widerstehen? Auch sie würde sie gern einmal berühren, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Aber sie ist nicht der Typ Mensch, für den sich Engel interessieren. Na, geht's dir gut? Sie nickt. Jetzt erst fällt ihr der Grund für ihr Kommen ein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagt sie in einem Ton, der wie eine Entschuldigung klingt und nicht wie eine Gratulation. Er kommt zu ihr und nimmt sie in den Arm. Sie macht sich steif, sie will nicht, daß er sie so an sich drückt. Sie hat Lust, ihm zu sagen, daß man mit gewissen Gesten nicht leichtfertig umgehen sollte, und schon gar nicht bei einem so konventionellen Anlaß. Man muß vorsichtig sein und den geeigneten Augenblick wählen. Seine Arme halten sie fest umschlungen, die gespreizten Hände drücken gegen ihren Rücken. Es gelingt ihr, sich für einen kurzen Moment gehenzulassen, dann lösen sich die Arme wieder von ihr, aber der Eindruck bleibt. […]
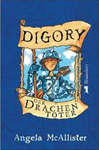
Angela McAllister, Digory, der Drachentöter, Bloomsbury, 2006
Digory, ein schüchterner und verträumter Junge, findet im Wald einen riesigen Zahn, der nur von einem Drachen stammen kann! Stolz steckt er sich den Zahn an den Hut und wird im Dorf als Drachentöter gefeiert. Digory wagt nicht zu widersprechen, auch nicht, als er zum Ritter geschlagen wird. Auf seinem tauben Pferd Gerste wird er in die Welt geschickt, um ritterliche Taten zu vollbringen. Kann sich Digory als Ritter bewähren?
Leseprobe / Seite 18-22
[…] WIE SCHNELL SICH ALLES HERUMSPRICHT
Als Digory an diesem Nachmittag nach Hause kam, machten die Dorfbewohner große Augen. Sie zeigten auf seine Mütze, tuschelten und stießen sich leise an. Zuerst fiel Digory, der sein Zahnlied vor sich hin summte, gar nichts auf. Dann brach jemand in Jubelrufe aus. Menschen kamen vom Markt herbeigerannt und begannen zu klatschen und zu pfeifen. Langsam fühlte sich Digory unwohl in seiner Haut. Er sah sich um. Nein, hinter ihm ritt keine berühmte Persönlichkeit. Sogar die Dorfjungen jubelten niemand anderem zu als ihm.
Im Nu waren die Leute aus ihren Geschäften und Häusern geströmt, um einen Blick auf Digory zu werfen, wie er durchs Dorf ging.
"Ein dreifaches Hurra für Digory!", riefen sie.
"Digory hat den Drachen getötet!"
Kinder sprangen an ihm hoch, um seine Mütze zu berühren.
"Seht euch den Zahn an, genau, was Noggy gesagt hat! Digory hat uns vor dem Drachen gerettet! Hurra, wir sind gerettet!"
Plötzlich begriff Digory.
"Aber … aber …", protestierte er. "Das habt ihr völlig falsch verstanden. Ich habe den Zahn nur gefunden, einen Drachen habe ich nicht mal gesehen." Aber Diskutieren hatte keinen Sinn. Niemand hörte ihm zu. Digory wurde von der Menge auf die Schultern genommen und wie ein Held zum Marktplatz getragen, wo sich das ganze Dorf versammelt hatte und er bereits von Junker Dickbauch persönlich erwartet wurde.
Junker Dickbauch hatte ihn schon immer ziemlich eingeschüchtert. Der Junker trug eine gelbe Weste und einen schwarzen Schnurrbart und klopfte den Leuten auf den Rücken, um freundlich zu sein. Digory wäre am liebsten weggelaufen, aber wo hätte er sich verstecken sollen? Der Junker hielt Digory sein großes Schnurrbartgesicht direkt vor die Nase und starrte ihn verdutzt an."Das ist er?", fragte er in die Menge.Die Dorfbewohner jubelten."JA!", brüllten sie. "Das ist er!"
Also schüttelte der Junker Digory die Hand und klopfte ihm, wie sollte es anders sein, kräftig auf den Rücken (dabei machte er eine Delle in die Laute, und Digory schnappte nach Luft).
"Tjaja", lachte der Junker. "Wer hätte gedacht, dass dieser junge Karottenkopf unser Dorf ohne jede Hilfe vor dem Drachen retten würde!"
"Dem blutgierigen Drachen!", rief ein Ackerknecht aus der Menge.
"Dem blutgierigen, Knochen knackenden Drachen mit seiner knurrenden Schnauze!", brüllte der Fleischer.
"Dem blutgierigen, Knochen knackenden, Fleisch zerfetzenden Drachen mit seiner knurrenden Schnauze und seinem geifernden Rachen!", schnatterte eine alte Damen von hinten.
Menge tobte. Aber Digory wurde von all dem blutrünstigen Gerede ganz schwindelig. "Eine Ansprache, eine Ansprache!", rief die Menge.
Der Junker gab Digory einen Schubs. Die Dorfbewohner verstummten. Digory starrte in ihre erwartungsvollen Gesichter.
"Ich glaube … ich glaube … ich … uahhh …" Und er wankte und schwankte und fiel auf der Stelle in Ohnmacht.
In diesem Augenblick traf Digorys Mutter ein. Mit einem heißen Schürhaken bahnte sie sich einen Weg durch die Menge.
"Platz da, Platz da! Wo ist mein Junge? Wo ist mein kleiner Digory?" Und schon hatte sie Digory mit ihren starken Armen hochgenommen, klopfte ihm den Staub ab und legte ihn sich über die Schulter. Wieder brach die Menge in Jubel aus.
"Sie können sehr stolz auf Ihren Sohn sein, Betsy", sagte der Junker. "Er ist ein großer Held. Er hat dieses Dorf vor dem blutgierigen, Knochen knackenden, Fleisch zerfetzenden Drachen mit seiner knurrenden Schnauze und seinem geifernden Rachen gerettet. Ihm zu Ehren werden wir ein Festmahl halten. Wir werden ihn zum Ritter schlagen und ihm den Namen ‚Sir Digory der Drachentöter' geben!"
Digorys Mutter strahlte wie ein Schmelzofen, und eine Träne kullerte zischend an ihrem glühenden Gesicht herab.
"Das ist mein Junge", schniefte sie voller Stolz. "Ich habe wirklich nicht gewusst, dass es in ihm steckt." Sie machte – in ihrer Lederschürze – vor dem Junker einen Knicks und trug Digory nach Hause, um ihn in die Regentonne zu tunken.
EIN PAAR WORTE ZUM THEMA SCHLAUHEIT
Das Dorf, in dem Digory lebte, nannte sich Dummdez. Du kannst dir also vielleicht vorstellen, was für Menschen dort lebten. In Dummdez hatte noch nie irgendjemand etwas Schlaues getan.
Einmal sah Bauer Jakobskraut, wie nachts eine Sternschnuppe in den Teich fiel, und obwohl er die ganze Nacht danach fischte, fand er sie nie. Und Meg, die Kuhhirtin, behauptete, mit den Kühen sprechen zu können, aber weil keiner hören wollte, was eine Kuh zu sagen hat, interessierte sich niemand dafür.
Die Leute hielten Junker Dickbauch für den schlauesten Mann im Dorf, einfach weil er der Junker war. Aber niemand von ihnen war schlau genug, um zu wissen, wie schlau er wirklich war. Und der Junker selbst, so schlau er vielleicht war, kannte jedenfalls keinen schlaueren Menschen, mit dem er sich hätte messen können. Woher sollte er es also wissen? Kapiert?
Als Digory nun mit seinem Drachenzahn an der Mütze heimkehrte, zerbrach man sich deshalb nicht gerade den Kopf darüber. Irgendwie kam niemand darauf, dass im Umkreis von Dummdez noch nie ein Drache gelebt hatte. Es war nämlich eigentlich ein denkbar schlechter Ort für Drachen. Es gab keine Felshöhlen, der Wald war licht und voller Unkraut, und es nieselte fast täglich, was dem feurigen Atem eines Drachen natürlich gar nicht gut bekommt. Und wer hat schon Angst vor einem Drachen, aus dessen Nasenlöchern nur Dampf quillt?
Aber um so etwas zu wissen, muss man eben schlau sein, oder? Als nun die Bewohner von Dummdez den Zahn sahen und hörten, dass er von einem Drachen sei, glaubten sie sofort, dass sie einem schrecklichen Schicksal entronnen seien. […]